Teil 3 – Nachhaltige Handhygiene und mehr
„Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen“ stellte kein geringerer als Johann Wolfgang von Goethe statt. Dieser Satz ist in den letzten Jahren etwas in den Hintergrund gerückt. Schließlich wurden Reisen in der Debatte um den Klimaschutz relativ oft auf Ausflüge mit dem Billigflieger nach Malle reduziert. Dass wir beim Reisen unser Bewusstsein mit unseren Sinnen erweitern, Vorurteile abbauen und die Einheimischen vor Ort mit unserem Geld unterstützen und damit letztlich Fluchtursachen bekämpfen, ist in der Klimadebatte komplett untergegangen. Nun ist die Klimadebatte selbst fast vom Bildschirm verschwunden. Mittlerweile dreht sich nun vieles um Verhaltensweisen, die für Reisende bereits vor der aktuellen Krise selbstverständlich waren: Es geht um das Tragen von Masken, das „Hamstern“ von Klorollen, das gründliche Händewaschen und die regelmäßige Auffrischung von Impfungen. Gleichzeitig wird in dieser besonderen Zeit an Solidarität, Disziplin und Respekt appelliert, sprich an ein faires Verhalten den Mitmenschen gegenüber. Rund um die vier genannten Punkte ergeben sich meiner Meinung nach Möglichkeiten, faires Agieren mit sinnvollen Veränderungen des eigenen Verhaltens im Alltag zu kombinieren. Und vielleicht eignen sich manche Verhaltensweisen auch für den Alltag nach der Krise.
In den ersten beiden Teilen dieser Serie widmete ich mich dem Umgang mit Masken und Toilettenpapier. Erstere sind in vielen Weltgegenden bereits vor Covid-19 Standard gewesen. Letzteres gibt es in vielen Regionen unserer Erde gar nicht zu kaufen. Das bedeutet natürlich nicht, dass es in anderen Kulturen unhygienisch zugeht – nur hygienisch auf eine andere Art und Weise. Durch die Verwendung von fair produzierten Masken und anderen Stoffprodukten aus Bio-Baumwolle bzw. die Nutzung von Toilettenpapier auf Recycling- oder Bambus-Basis lässt sich währende und nach der Krise fair konsumieren.

Teilweise ging es außerhalb Deutschlands bis zum Ausbruch von Covid-19 sogar ein Stück weit hygienischer zu. Dafür müssen wir nur ein paar Kilometer über die hoffentlich bald wieder geöffnete deutsch-französische Grenze fahren. Bestellten wir dort oder auch in Baku (Aserbaidschan) während des Aufenthalts für das EuropaLeague-Auswärtsspiel bei Qäbälä ein Eis in der Waffel, wurde es in einer kleinen Papiertüte um die Eiswaffel gereicht. Wer sich an die letzten Sommer bei uns erinnert, weiß, dass in den meisten Fällen die Eiskugeln in der Eiswaffel landeten und die Eisverkäufer*innen uns die Waffel mit den bloßen Händen überreichte. Danach wurde mit ihnen abkassiert und die dreckigen Münzen in Empfang genommen, ehe wieder mit den bloßen Händen die nächste Waffel befüllt wurde. Oder nehmen wir den Gang bei uns zur Bäckerei. Auch dort wurde bis dato oft das Brötchen oder Teilchen mit den bloßen Händen angefasst und in die Tüte gesteckt. Auch hier geht es im Ausland bereits seit Jahren oft hygienischer vor, indem Backwaren mit Handschuhen angegriffen werden und eine andere Person abkassierte oder die Handschuhe auf einem sauberen Platz abgelegt wurden, ehe es an das Abkassieren ging. Mittlerweile gibt es auch bei uns unter anderem für Eisdielen und Bäckereien strengere Hygieneauflagen und die genannten ganz simplen Standards, die ich von meinen Reisen her kannte, sind bei uns endlich auch Usus.

In vielen Ländern der Welt sind Messer, Gabel und Stäbchen natürlich nicht vollkommen unbekannt, liegen aber eigentlich nicht im Trend, um die leckeren Speisen zu verzehren. Besteck ist dort einfach kein Teil der Esskultur. In Südindien beispielsweise werden viele Currys mit Reis auf einem Bananenblatt ziemlich umweltfreundlich serviert: kein Einweggeschirr, kein Einwegbesteck, keine Servietten. Da das Essen mit der rechten Hand zum Mund geführt wird, ist es vollkommen normal, dass man sich spätestens nach dem Bestellen im Restaurant die Hände gründlich mit Seife wäscht. Denn die Hemmschwelle mit dreckigen Fingern zu Essen liegt natürlich wesentlich niedriger, wenn man kein Besteck zur Hand hat als mit dreckigen Fingern Messer und Gabel zu nutzen. In vielen Ländern der Welt wird auch Fladenbrot zum Essen gereicht, zum Beispiel in den arabischen Ländern. Auch dort brechen die Menschen vor dem Essen vom Tisch auf, um sich die Hände vor dem Essen nochmal gründlich zu reinigen. Auch nach dem Essen ist es vollkommen normal sich die Hände wieder mit Seife zu waschen. Schließlich möchte man natürlich nicht, dass man auch Stunden später am Geruch der Hände erkennen kann, was es zu Mittag oder zum Abendessen gab. Daher gibt es Wasserhähne mit Seife meistens sogar im Speiseraum selbst und nicht nur im Bad.

Dass wir uns alle mittlerweile öfter die Hände waschen und Bäckereien und Eisdielen jetzt auch beim Verkauf noch etwas mehr auf Hygiene achten ist prima. Doch leider korreliert Covid-19 nicht nur mit verbesserter Hygiene, sondern auch mit viel mehr Müll. Ich war beispielsweise diese Woche beim Frisör. Wurde bisher mein Oberkörper mit einem Stofftuch abgedeckt, kam jetzt eine Einweg-Plastikfolie zum Einsatz. Theoretisch könnte man das Stofftuch nach dem Gebrauch auch einfach in die Waschmaschine stecken, es bei 60 Grad waschen, und/oder bügeln und es bedenkenlos wiederverwenden. Und natürlich wollte ich in der Zeit, als die Restaurants geschlossen waren, auch die Mainzer Lokale unterstützen und habe „To-Go“ bestellt. Leider wurden viele Speisen in Einwegplastik geliefert – was sich natürlich auch nicht immer vermeiden lässt, wenn Sößchen mitgeliefert werden. Aber ständig Pizza im Pappkarton zu bestellen, war mir ehrlich gesagt des Guten zu viel. Aber beim Händewaschen ist es ziemlich einfach auf Plastik zu verzichten.
Um die Hände gründlich zu reinigen ist Seife ein Muss, da durch die Inhaltsstoffe Bakterien und Viren abgetötet werden. Die ersten die eine Art Seife herstellten waren die Sumerer im heutigen Irak vor 4500 Jahren. Aber auch die Germanen kamen schon auf den Trichter, sich mit Seife zu reinigen. Erfinder der festen Seife, so wie wir sie heute kennen, waren die Araber im 7. Jahrhundert n. Chr. Die bis dahin verwendete Pottasche wurde durch gebrannten Kalk ersetzt, um der Seife ihre Festigkeit zu verleihen. Auch in Europa wurde die Seife der Renner, genauso wie Badehäuser.

Es war eine Epidemie, die dem Seifenkonsum den zwischenzeitlichen Garaus machte. Da man damals nicht wusste, dass die dreckigen Gossen der Nährboden für Pest und Cholera waren, nahmen die Menschen an, das Wasser sei daran schuld. Daher bevorzugte man für viele Jahrzehnte die Trockenwäsche mit Puder. Das Ergebnis: die Pest raffte zirka 25 Prozent der damaligen Bevölkerung Europas dahin. Das Wissen um die Hygiene ließ die Seife ab dem frühen 19. Jahrhundert wieder zu alten Höhenflügen ansetzen. Leider wird das klassische Seifenstück mehr und mehr durch Flüssigseife ersetzt. Diese wird eigentlich immer in Plastikbehältnissen verkauft, wohingegen das Seifenstück bis heute in einer Pappverpackung daherkommt. Die Waschleistung ist bei beiden Produkten identisch. Allerdings ist die Flüssigseife deutlich teurer. Es gibt also eigentlich keinen ersichtlichen Grund, die Umwelt mit Flüssigseifenverpackungen aus Plastik zu belasten. Auch Nachfüllpackungen aus recycelter Plastik sind da nur Greenwashing. Mittlerweile gibt es sogar festes Duschgel und Shampoo aus Naturkosmetik – z.B. auch in den großen Drogeriemarktketten.
Wer sich noch einen Tick nachhaltiger die Hände waschen möchte, dem seien zum Beispiel die „share“ Produkte empfohlen, die es bereits in einer Supermarkt- und Drogeriemarktkette gibt. Zwar bietet „share“ ebenfalls Flüssigseife an, aber eben auch die klassischen Seifenstücke. „Share“ heißt auf Deutsch teilen. Das ist das Prinzip bei allen „share“ Produkten. Wir kaufen zum Beispiel ein Stück Seife. Dadurch spendet „share“ ein Stück Seife an Hilfsbedürftige. „share“ definiert dies als so genannten „sozialen Konsum“. Die Zutaten stammen aus nachhaltigen Quellen und auf jeder Packung können wir mit Hilfe eines QR-Codes nachvollziehen, wohin unser geteiltes Produkt geht. Es werden Initiativen in Deutschland und weltweit unterstützt. Gerade Seife ist in vielen Teilen der Welt keine Selbstverständlichkeit und für manche sogar ein Luxusgut. Daher hat zum Beispiel „Helfende Hände für Nepal Mainz e.V.“ bei den gepackten Notpaketen für Bedürftige in Nepal auch immer Seifen beigefügt. Zwei dieser Pakete konnten wir durch den Erlös mit den Turnbeuteln, den Soulbottles und meinen Büchern im Direktverkauf im April 2020 finanzieren.
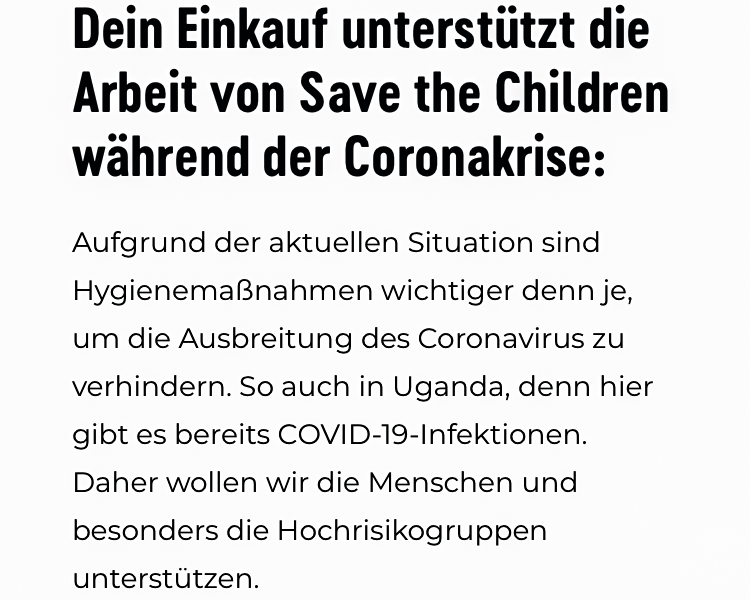
Es bieten sich uns also tatsächlich Möglichkeiten, hygienisch einwandfrei durchs Leben zu ziehen und dabei sogar noch grenzenlose Solidarität beim Einkauf im Supermarkt walten zu lassen und auf eine faire Art und Weise unsere Hände zu waschen.
Quellen:
„Die Geschichte der Seife“: https://www.ndr.de/geschichte/Die-Geschichte-der-Seife,seife196.html
„Teilen für eine bessere Welt“: https://www.share.eu/
Werbung: unbeauftragt, selbst bezahlt
Bilder: Meenzer-on-Tour, Pixabay
Teil 1: Fairmummung, ja bitte!

